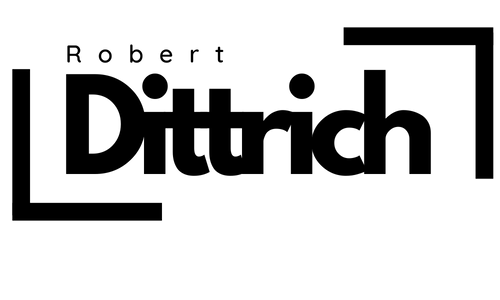Ist Remote Work am Ende? Oder haben wir in Deutschland einfach noch nicht gelernt, damit richtig umzugehen?
Klar, die Idee von Remote Work klingt nach Freiheit pur: Arbeiten am See, im Café oder von der Couch. Aber wenn man auf die Stellenanzeigen hierzulande schaut, sieht’s düster aus. Immer weniger Unternehmen bieten echte Remote-Jobs an. Heißt das, das Modell ist gescheitert? Auf keinen Fall – es zeigt eher, dass wir in Deutschland einfach noch nicht verstanden haben, wie man Remote Work wirklich lebt.
Ja, die Pandemie hat Remote Work einen Schub verpasst, aber mal ehrlich: Viele Firmen haben nur schnell ein paar Tools installiert, anstatt das Potenzial wirklich auszuschöpfen. Jetzt, wo das Thema nicht mehr so brennend ist, sieht es aus, als hätten sie es wieder auf die lange Bank geschoben. Stellenanzeigen für Remote-Jobs stagnieren, und das, obwohl immer mehr Menschen genau das wollen. Und nicht nur das – die Zahl der Angebote geht sogar zurück, von über 982.000 im Jahr 2023 auf rund 591.000 in 2024. Das ist immer noch mehr als vor fünf Jahren, aber der Boom ist definitiv vorbei.
Dabei ist Remote Work keine Modeerscheinung, sondern die Zukunft der Arbeit – gerade in einem Land wie Deutschland, wo wir immer noch an überholten Modellen wie der Stechuhr hängen. Es geht nicht nur darum, den Laptop ins Homeoffice zu verlagern, sondern um eine echte Revolution im Arbeitsalltag. Eine Revolution, die wir dringend brauchen, um in der globalen Arbeitswelt mitzuhalten.
Und das Argument, dass die Konjunktur schuld ist, zieht nur teilweise. Sicher, weniger Stellenanzeigen bedeuten weniger Remote-Jobs. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Die IT-Branche, Marketing und Forschung zeigen doch, dass es anders geht. Diese Sektoren haben den höchsten Anteil an Remote-Stellen. Woran hapert es also? Es fehlt an Führungskräften, die wissen, wie Remote Work funktioniert und vor allem, wie man es effektiv managt.
Auch das Homeoffice, das oft als kleine Schwester des Remote Work betrachtet wird, stagniert. Jeder Vierte arbeitet aktuell teilweise oder komplett von zuhause. Aber das könnte jeder Zweite sein, wenn wir die Möglichkeiten richtig nutzen würden.
Stanford-Forscher: Das volle Potenzial bleibt ungenutzt
Nicholas Bloom, einer der führenden Köpfe auf dem Gebiet der Remote-Arbeit, sieht den aktuellen Stand eher ernüchternd: Laut dem Stanford-Ökonom stagniert die Entwicklung und ist regelrecht festgefahren. „Es bräuchte schon eine Krise vom Ausmaß der Pandemie, um hier wieder Bewegung reinzubringen,“ lautet seine Einschätzung. Auch wenn seine Forschung vor allem auf die USA abzielt, lassen sich Blooms Erkenntnisse problemlos auf andere Industrienationen übertragen.
Was läuft schief? Bloom kritisiert, dass viele Unternehmen mit dem Ende der Coronakrise ihren Modernisierungseifer eingestellt haben. Besonders gravierend: Es fehlt an Führungskräften, die wissen, wie Remote Work wirklich funktioniert und diese effizient managen können. Und dann sind da noch die unterschiedlichen globalen Gesetzgebungen, die das grenzenlose Arbeiten erschweren. Das Ergebnis: Das immense Potenzial von Remote Work wird bei weitem nicht ausgeschöpft.
Was wir brauchen?
Was wir brauchen, ist ein Umdenken. Es reicht nicht, die Pandemie als Ausnahmezustand abzutun und zu hoffen, dass alles wieder „normal“ wird. Remote Work ist die Zukunft, und wer das verschläft, bleibt auf der Strecke. Besonders hier in Deutschland müssen wir endlich den Schritt wagen und lernen, wie man ortsunabhängiges Arbeiten richtig umsetzt – und das nicht nur als Notlösung, sondern als festen Bestandteil der modernen Arbeitswelt.
Das alte Modell der Lochkarten hat ausgedient. Es ist Zeit, dass wir aufwachen und die Chancen, die Remote Work bietet, voll ausschöpfen.